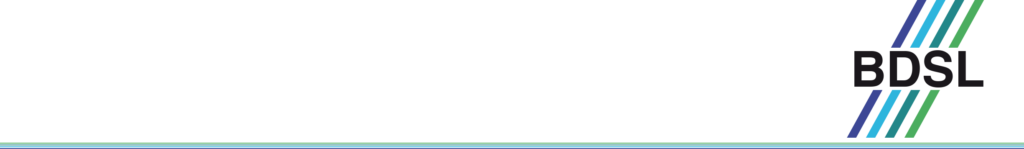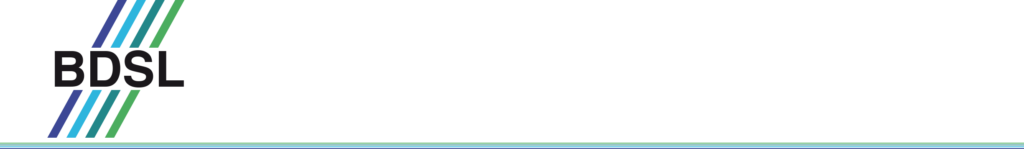Darkow, R., Faust, J. und Kroker, C. (2024). Leitfaden zur Elektrotherapie in der Logopädie. Elektrostimulation: Basiswissen und Praxis für die Logopädie. Schulz-Kirchner-Verlag. 192 Seiten. 978-3-8248-1321-6.
Die fach- und störungsspezifisch aufgestellte Autorenschaft stellt sehr gut den sprachtherapeutischen Leitfaden zur Elektrostimulation von Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen logopädischen Störungsbilden für eine Leserschaft dar, die sich als erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten im neurologischen Fachbereich neu in die komplexe neurogene Thematik einlesen möchten.
Zunächst werden anschaulich die unterschiedlichen physikalischen und physiologischen Grundlagen von Elektrostimulationen (ES) überblicksartig dargestellt sowie physikalische Parameter wie Stromkreise, (galvanische) Stromformen und -maße (wie Stromstärke, Widerstand, Spannung, etc.) mit Beispielen und Begründungen sachdienlich und verständlich erklärt. Des Weiteren stellen die Autoren die physikalischen, (bio)chemischen und physiologische Reaktionen u.a. in der Zelle bei und nach Stimulation vertiefend dar, um einerseits Kenntnisse über ES zu erlangen, andererseits um die Entscheidungsfindung der Interventionswahl zu unterstützen. Hilfreich sind an dieser Stelle auch Ausführungen zur Wirkung von elektrischem Reiz auf Muskeln (muskelfunktionelle Stimulation) und Neuronen (Gehirnstimulation) sowie deren Unterschiede. Auch gehen die Autoren anfangs auf ihre Ziele und Zielgruppe ein, erklären und begründen die Wirkung von elektrischem Reiz auf Muskeln (FES = funktionelle Elektrostimulation) und Neuronen (tDCS = transkranielle Gleichstromstimulation/ transcranial direct current stimulation). Genauso klären die Autoren über physikalisch-chemische Reaktionen in der Zelle auf, die aufgrund ihres Ruhe- und Aktionspotentials eine entscheidende Funktion der Stimulation innehaben.
Die Autoren weisen bewusst kontrovers und dezidiert auf Kontraindikationen und Vorsichtsmaßnahmen mit ES hin, wobei sie auch die Kriterien für FES und tDCS spezifizieren und strukturieren.
In der Vertiefung der Grundlagen zur FES erläutern die Autoren Stromformen und ihre Auswirkungen (teilweise gewünscht redundant), wobei sie faradischen Strom, Dreieck- und Rechteckstrom hervorheben, da diese in der Therapie unterschiedlichen Einsatz finden können. Außerdem gehen die Autoren detailliert auf die Reaktionen von gesunden und denervierten Muskeln ein. Weitere Anwendungen wie flache oder steile bzw. lange Stromanstiege finden Erwähnung und werden anhand von Beispielen anschaulich erläutert. Die Errechnung des α-Wertes als Maß der Schädigung eines Muskels wird auch beispielhaft dargelegt.
Neben der ausführlich vorgestellten Anwendung von FES bei Facialisparesen und Larynxparesen gehen die Autoren auch auf die Anwendung der FES bei Dysarthrie und Dysphagie ein. In allen o.g. Störungsbereichen stellen die Autoren aktuelle evidenzbasierte Studien vor und diskutieren diese.
Daneben vertiefen die Autoren die Anwendung der tDCS hinsichtlich ihrer Komponenten, Aufbau und Stimulusparameter zusätzlich. Auch stellen sie die Anwendung sowie den aktuellen Forschungsstand bei Aphasie, Dysphagie und Stottern in Kombination mit tDCS vor und gehen speziell auf jede Stimulation sehr anschaulich ein.
Insgesamt entsteht ein gelungener fachspezifischer, kurzweiliger, detailreicher Leitfaden zu allen relevanten Themen rund um die Elektrostimulation in der Logopädie. Wir dürfen auf die erwähnten Fortbildungen gespannt sein!
Rezensentin: Dr. Angela de Sunda (Akademische Sprachtherapeutin aus der Berufsfachschule für Logopädie in Würzburg)